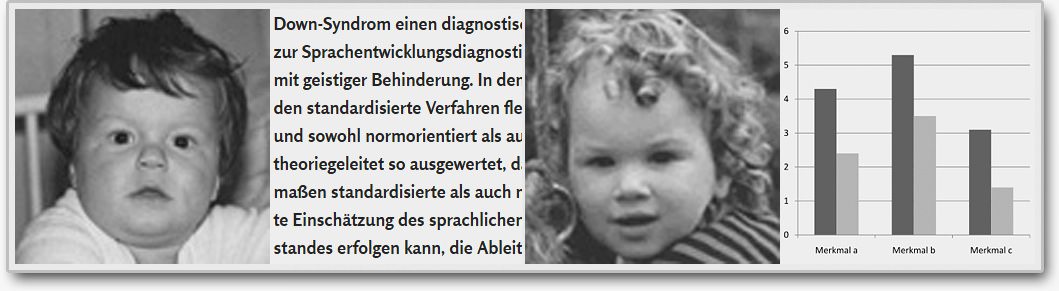Alltagsintegrierte Sprachbildung NRW
Seit 03/2015 biete ich als zertifizierte Multiplikatorin Fortbildungen zur Alltagsintegrierten Sprachbildung und Dokumentation im Elementarbereich an, die dem Curriculum für NRW folgen und auch entsprechend vom Land gefördert werden können. Über die Jahre ist ein breites Repertoire an Seminarthemen entstanden.
Beispiele für ein- bis zweitägige Fortbildungen:
- Das Faszinosum „Spracherwerb“: Meilensteine und Stolpersteine beim Sprechen lernen
Ein Seminar zu den Meilensteinen des Spracherwerbs? Warum das? Der Spracherwerb ist Fachkräften doch gut vertraut. Aber haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wie genau die Kinder das eigentlich machen? Oder haben Sie sich gewundert, wieso manche Zweijährige schon in ganzen Sätzen „die Welt erklären“ können, während andere Kinder mit fünf Jahren immer noch Schwierigkeiten haben einen kurzen korrekten Satz zu formen?
In diesem Seminar nehmen wir die Meilensteine des Spracherwerbs unter die Lupe und betrachten, wo für manche Kinder „Stolpersteine“ entstehen. Wer diese Tücken kennt und weiß, welche Lernstrategien Kinder üblicherweise verwenden, um sich die Welt der Sprache zu erschließen, kann sie auch bestmöglich dabei unterstützen. Bringen Sie Ihre Fragen gerne mit. -
Sprachbildung bei den Kleinsten
In diesem Seminar nehmen wir den frühen Spracherwerb bei ein- und mehrsprachigen Kindern unter die Lupe.
Wie kommt es, dass sich manche Kinder sprachlich scheinbar mühelos und schnell entwickeln, andere dahingegen deutlich langsamer sprechen lernen? Und was ist überhaupt „normal“ im Spracherwerb im Alter von 0-3 Jahren?
Wir werden uns anschauen, mit welchen Fähigkeiten und Lernstrategien ein Kind auf wie Welt kommt und wie es sich die Sprache erschließt. Aufbauend auf diesem Wissen über den Spracherwerb lässt sich ableiten, wie eine passende sprachliche Umwelt für die Kleinsten aussehen sollte. Die TeilnehmerInnen können Spiele, Bücher, Lieder mitbringen, die sie gerne im Alltag mit den Jüngsten einsetzen. Anhand dieser können wir praxisnah überlegen, welche frühen kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen damit in besonderer Weise unterstützt werden. -
Das Wundermittel „Sprachlehrstrategien“: mühelos einsetzbar - maximal wirksam“
Wenn Kinder sprechen lernen, passen die erwachsenen Bezugspersonen aus dem Bauch heraus ganz automatisch ihre eigene Sprache dem sprachlichen Können des Kindes an. So betont man z.B. bestimmte Wörter im Satz besonders stark, bis das Kind sie nachspricht oder gibt das, was das Kind „falsch“ gesagt hat in „richtiger Form“ wieder zurück. Je nach Entwicklungsstand des Kindes ändern sich diese Sprachlehrstrategien. Daher gibt es eine Vielzahl! Das Tolle an den Sprachlehrstrategien ist, dass sie im Alltag problemlos und situationsübergreifend eingesetzt werden können, und nachgewiesenermaßen alle Kinder sprachlich sehr gut fördern! Ein echtes Wundermittel der alltagsintegrierten Förderung, wenn man sie bewusst und gezielt einsetzt.
Im Seminar werden Sie die Bandbreite der Sprachlehrstrategien kennenlernen und verstehen, warum sie so wirksam sind. Dabei werden wir uns bewusst machen, wie wir sie maximal wirksam einsetzen können und den Einsatz auch erproben. -
Wortschatzförderung in der Kita: Methoden zur Förderung des aktiven und passiven Wortschatzes
In diesem Seminar legen wir den Fokus auf den Worterwerb. Mit einem Jahr sprechen viele Kinder das erste Wort, im Verlauf der nächsten Monate lernen sie erst langsam, später immer schneller neue Wörter hinzu. Wie machen sie das eigentlich? Und wie können wir in der Kita den Worterwerb von ein- und mehrsprachigen Kindern unterstützen? Gibt es spezielle Methoden, die sich eignen? Wenn ja, welche sind das? Und was können wir für Kinder tun, die sich schwertun, ihren aktiven und passiven Wortschatz zu vergrößern? -
Nonverbale Kommunikation mit Kindern
Neben der Sprache steht uns die nonverbale Kommunikation als Verständigungsmöglichkeit zur Verfügung. Insbesondere bei Kindern mit Sprachproblemen sowie bei Kindern, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse in die Einrichtung kommen, müssen wir auf nonverbale Mittel zurückgreifen. In diesem Seminar geht es nicht um das Erlernen einzelner Gebärdensysteme, sondern um eine Sensibilisierung für unterschiedliche Formen nonverbaler Kommunikation (Blick, Gestik, Mimik, Stimme, Körperhaltung) und darum, welche Rolle diese beim Spracherwerb spielen. Wir werden sehen, wie die nonverbalen Mittel sinnvoll eingesetzt werden können, um ein- und mehrsprachige Kinder beim Spracherwerb zu unterstützen. -
Mehrsprachigkeit in der Kita begegnen
Der Kita-Besuch ist für mehrsprachig aufwachsende Kinder eine große Herausforderung – und für die Fachkräfte auch: Jedes Kind bringt seine eigene Sprachlern-Biografie und individuelle Lernvoraussetzungen mit. Manche Kinder lernen mühelos mehrere Sprachen, andere tun sich schwer. Im Seminar ist Raum, auf Ihre Fragen einzugehen, z.B.: Wie lernen Kinder mehrere Sprachen? Wie können wir Mehrsprachigkeit in unserer Kita fördern? Unter welchen Bedingungen lernen die Kinder am besten Deutsch? Wie beziehen wir die Eltern sinnvoll ein? Woran erkenne ich, ob ein mehrsprachiges Kind eine Sprachtherapie braucht? -
Zusammenarbeit mit mehrsprachigen Familien
Die Zahl der mehrsprachig aufwachsenden Kinder in unseren Kitas steigt und die Gemeinschaft wird vielfältiger und bunter. Wenn viele unterschiedliche Sprachen, Kulturen und auch Religionen zusammenkommen, gibt es aber auch Herausforderungen. Vor allem wenn sprachliche Barrieren zu den Eltern bestehen, wird der Austausch erschwert. Weniger augenfällig sind kulturelle Unterschiede in Erziehungspraktiken und -idealen, an Erwartungen an das Kind oder die Fachkräfte u.v.m.
In diesem Seminar werden wir uns anschauen, welche Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit mehrsprachigen Familien auftreten und sehen, dass es hilft, mehr voneinander zu wissen, um vertrauensvoller und besser im Sinne der „Erziehungspartnerschaft“ miteinander zu arbeiten.
Bringen Sie Ihre Fragen und Ideen zum Thema gerne mit. Neben Informationsvermittlung wird genug Zeit für den Erfahrungsaustausch vorhanden sein! -
Sprache und emotionale Entwicklung
Die sprachliche Entwicklung von Kindern ist eng mit anderen Kompetenzbereichen verwoben. Wir betrachten in diesem Seminar das Wirkungsgefüge zwischen der sprachlichen und der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern. Wie wirken sich sprachliche Entwicklungsprobleme auf das Verhalten aus (Aufmerksamkeit, Konflikte, Emotionsregulation)? Wie erkennen wir, ob sprachliche Probleme „schwierigem Verhalten“ von Kindern zugrunde liegt? Und was können wir tun?
Wie wirken sich umgekehrt sozial-emotionale Entwicklungsprobleme (Unsicherheit, Schüchternheit, Bindungsprobleme, Traumata) auf das sprachliche Lernen aus? Was können wir hier tun?
Die Themen werden anhand konkreter Situationen und Beispiele aus dem Kita-Alltag besprochen. Bringen Sie Ihre Themen und Fragen mit! -
(Sprach-)Auffälligkeiten bei Kindern: Wie sage ich es den Eltern?
Eltern nehmen als primäre Interaktions- und Bezugspersonen eine wesentliche Rolle in der Gesamtentwicklung und somit auch in der Sprachentwicklung ihrer Kinder ein. Die aktive Einbeziehung der Eltern ist damit wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit, aber auch eine Herausforderung: Unterschiedliche Werte, Ziele oder Sichtweisen führen in der gemeinsamen Bildungsarbeit mit Eltern jedoch manchmal zu Konflikten. Manchmal sind es auch sprachliche und/oder kulturelle Hürden, die die Zusammenarbeit erschweren. (Konflikt-) Gespräche professionell zu führen und Lösungswege einzuschlagen, erfordert eine gute Vorbereitung, z.B. auf folgende Fragen: Ab wann ist ein Verhalten / eine Entwicklung überhaupt „auffällig“? Wann und worauf sollte ich die Eltern ansprechen? Wie möchte ich das Gespräch gestalten und führen? Was mache ich, wenn Eltern meine Ratschläge ignorieren? u.v.m.
Für das Gelingen eines Elterngesprächs spielen auch der eigene Selbstwert und der wertschätzende und ressourcenorientierte Blick auf die Eltern eine große Rolle. Diese Fortbildung möchte Impulse setzen und Ihnen Handwerkszeug für Konfliktsituationen in der Elternarbeit mitgeben. -
Sprachförderung aus inklusiver Sicht:
Kinder bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen für den Spracherwerb mit. Manchen Kindern fällt das Sprechenlernen leicht, andere haben eine geistige Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigungen in anderen Entwicklungsbereichen (Sinne, Psyche), die ihnen den Spracherwerb erschweren. In diesem Seminaren nehmen wir Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen in den Fokus: Wie können wir die passende Sprachumwelt für das jeweilige Kind schaffen? Was unterscheidet die Sprachförderung bei diesen Kindern von der üblichen alltagsintegrierten Sprachbildung, was ist gleich? Fallbeispiele sind willkommen. -
Früherkennung von behandlungsbedürftigen Entwicklungsauffälligkeiten der Sprache"
Kinder entwickeln sich sprachlich unterschiedlich schnell und das ist ganz normal. Bei manchen Kindern machen wir uns jedoch Sorgen: Da ist der Dreijährige, der erst wenige Wörter spricht, die Vierjährige, die man kaum verstehen kann oder das mehrsprachig aufwachsende Kind, das immer noch kein Deutsch spricht.
Welche sprachlichen Verzögerungen und Auffälligkeiten sind eigentlich „normal“ – und wann könnte ein behandlungsbedürftiges Sprachproblem vorliegen? Wie früh und auf welche Weise kann ich Entwicklungsrisiken erkennen? Wie können die vorgeschriebenen Beobachtungsbögen (BaSik, sismik/seldak/liseb) genutzt werden? Was sind die weiteren Schritte, wenn ein Verdacht auf ein Sprachproblem vorliegt? Was sollte mit den Eltern besprochen werden? Wer sind weitere Ansprechpartner? Bringen Sie Ihre Fragen mit! -
Alltagsintegrierte Sprachbildung: Welche Rolle spiele ich dabei?
Kinder kommen zwar mit angeborenen Sprachlernfähigkeiten zur Welt, um sprechen zu lernen, sind sie aber auf Interaktionen mit „echten Menschen“ angewiesen. In der Kita sind es die pädagogischen Fachkräfte, die mit ihrem eigenen Sprachvorbild und ihrem Kommunikationsverhalten einen wesentlichen Beitrag zum ungestörten Spracherwerb der Kinder leisten.
In diesem Seminar werden wir zunächst betrachten, welches Sprachverhalten Erwachsener die Kinder besonders gut beim Spracherwerb unterstützt. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit uns selbst auseinandersetzen: Welche Bedeutung haben Sprache und Sprechen für mich persönlich? Wann bin ich ein gutes Sprachvorbild für die Kinder, wann eher nicht? Wo und wann gelingt es mir, (sprachliche) Interaktionen mit Kindern und zwischen ihnen zu fördern, wann eher nicht? Wo sehe ich Veränderungspotential bei mir selbst? Wo in strukturellen Aspekten unserer Einrichtung?
Sie haben konkrete Fragen zur Alltagsintegrierten Sprachbildung NRW oder möchten einen Termin vereinbaren?